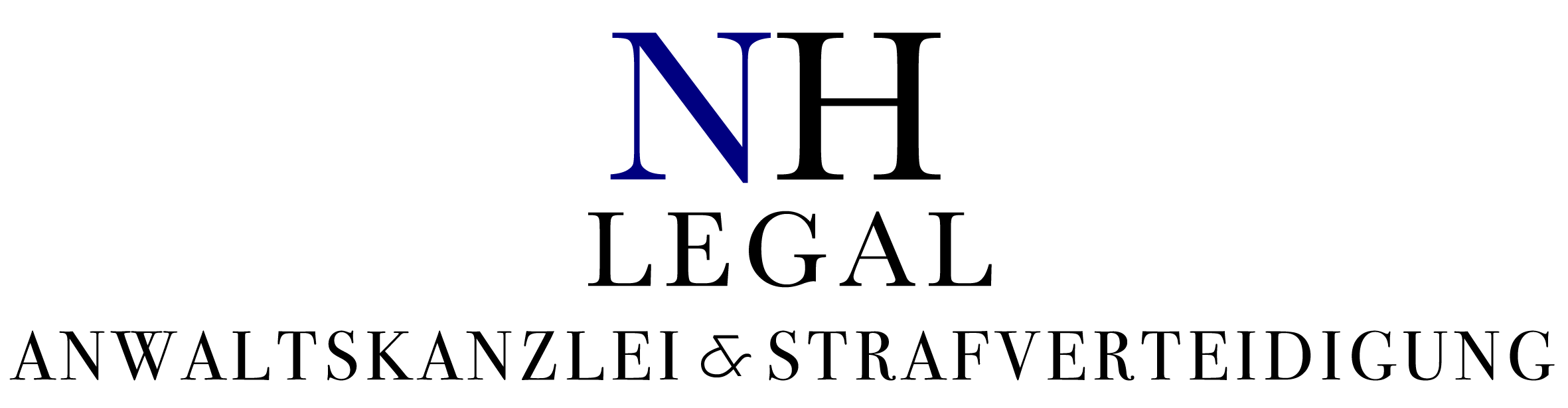Verkehrsstrafrecht
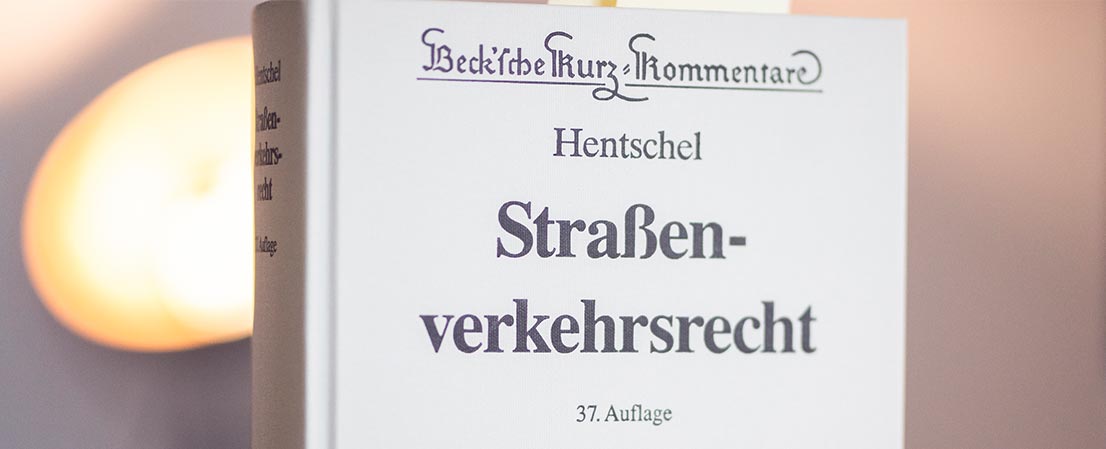
Verkehrsstraftaten passieren täglich auf Deutschlands Straßen und nahezu jeder Auto- oder Motorradfahrer ist damit schon mal in Berührung gekommen. Verkehrsstraftaten sind von einfachen und den üblichen Ordnungswidrigkeiten strikt zu trennen. Sie dienen in erster Linie zur Sicherheit des Straßenverkehrs. Wer eine Verkehrsstraftat begeht, kann mit Geld- oder Freiheitsstrafe sanktioniert werden. Daneben wird regelmäßig – als Nebenstrafe – der Führerschein für eine festgelegte Dauer entzogen. Die meisten fürchten nicht die Sanktionierung, sondern den Führerscheinentzug und die damit verbundenen weiteren Regelungen zur Wiedererlangung wie Aufbauseminar, MPU, Abstinenznachweis, usw. Zu den Verkehrsstraftaten gehören auch u.a.:
Trunkenheitsfahrt (§ 316 StGB)
Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr (§ 315b StGB)
Gefährdung des Straßenverkehrs (§ 315c StGB)
Verbotene Kraftfahrzeugrennen (§ 315d StGB)
Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort (§ 142 StGB Fahrerflucht)
Fahren ohne Fahrerlaubnis (§ 21 StVG)
Kennzeichenmissbrauch (§ 22 StVG)
Fahren ohne Kfz-Haftpflichtversicherung (§ 6 PflVG)
und weitere Delikte, die in Verbindung mit dem Führen von Kraftfahrzeugen im Straßenverkehr begangen werden können. Neuerdings wird sogar bei dem Vorwurf von illegalen Kraftfahrzeugrennen das Fahrzeug als Tatmittel (§ 315f StGB) an Ort und Stelle eingezogen. Die vorläufige Entziehung des Führerscheins noch am Tatort, ist den meisten Fällen die Regel.
Alkohol und Drogen im Straßenverkehr, § 316 StGB
Häufig werden Verkehrsstraftaten mit Bezug zu Alkohol oder Drogen begangen. Hier kommt es auf die Konzentration des jeweiligen Wirkstoffes zum Zeitpunkt der Fahrt im Blut an. Es zählen Grenzwerte und diverse Berechnungsformel, um eine mögliche relative oder absolute Fahruntüchtigkeit feststellen zu können. Häufig werden diese seitens der Ermittlungsbehörden unzureichend angewendet bzw. zugrunde gelegt. Insofern reicht der bloße Vorwurf von Alkohol oder Drogen im Blut nicht aus. Grundsätzlich gilt, wer Alkohol oder Drogen konsumiert, sollte nicht fahren. Der Fahrer muss sich zum Tatzeitpunkt in einem Zustand befunden haben, in dem er nicht in der Lage war, das Fahrzeug sicher zu führen. Hier muss man zwischen relativer und absoluter Fahruntüchtigkeit unterscheiden.
Relative Fahruntüchtigkeit:Wird die durch Blutentnahme enthaltende Blutalkoholkonzentration (BAK) ausgewertet und ergibt diese einen Wert zwischen 0,3 und 1,1 Promille, so spricht man von einer relativen Fahruntüchtigkeit. Liegt der Wert zwischen 0,3 und 0,5 Promille, kann dies eine Straftat darstellen, wenn Ausfallerscheinungen hinzukommen. Das können Auffälligkeiten im Erscheinungs- oder Verhaltensbild des Täters sein. Ab einer BAK von 0,5 Promille kommt man jedoch an einer Ordnungswidrigkeit nicht mehr drum herum, auch wenn man konzentriert und vorbildlich fährt. Kommen hier noch Ausfallerscheinungen dazu, muss man sich mit dem Vorwurf einer Straftat auseinandersetzen.
Ähnlich wie bei Alkohol, gibt es auch bei Cannabisprodukten sogenannte „Grenzwerte“. Als Grenzwert wurde 1,0 Nanogramm THC festgelegt. Wird zusätzlich die Fahruntüchtigkeit festgestellt, begeht man in der Regel nicht mehr bloße eine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat.Es wird im Einzelfall die Feststellung der Fahruntüchtigkeit anhand einer umfassenden Würdigung der Anzeichen erforderlich. Ein Fahrfehler muss nicht zwingend vorliegen, sondern kann sich bereits aus dem Zustand und dem Verhalten des Fahrzeugführers bei einer Kontrolle ergeben. Das sind z.B. Wahrnehmungs- und Reaktionsfähigkeiten, mangelnde Ansprechbarkeit, koordinationslose Bewegung. Bloße erweiterte Pupillen oder gerötete Augen reichen hingegen nicht aus.
Absolute Fahruntüchtigkeit:Bei einer festgestellten BAK von 1,1 Promille und mehr, wird unwiderlegbar die absolute Fahruntüchtigkeit vermutet. Eine weitere Feststellung von fahrbedingten Ausfallerscheinungen, ist nicht erforderlich. So kann beispielsweise auch ein trinkfester Fahrer sich nicht darauf berufen, er sei einen bestimmten Pegel gewöhnt und sei nicht beeinträchtigt. Bei Fahrradfahrern besteht eine absolute Fahruntüchtigkeit erst ab einer BAK von 1,6 Promille. Wer Fahranfänger ist oder das 21- Lebensjahr noch nicht beendet hat, für den gilt die 0,0 Promillegrenze und darf daher gar kein Alkohol vor dem Fahren zu sich nehmen.
Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, 315b StGB
Beim gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, werden äußerst gefährliche, verkehrsfremde Eingriffe, die von außen her auf den Straßenverkehr einwirken, geahndet. Hierbei handelt es sich um Beeinträchtigungen der Sicherheit des Straßenverkehrs durch außenstehende, die Anlagen oder Fahrzeuge zerstören, beschädigen oder beseitigen (Nr. 1), Hindernisse bereiten (Nr. 2) oder einen ähnlichen, ebenso gefährlichen Eingriff vornehmen (Nr. 3) und hierdurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen gefährdet werden.
Folgende Beispiele fallen u.a. unter diesen Tatbestand: Manipulation von Bremsschläuchen, Lockern von Radmuttern, Werfen oder Legen von Schildern, Steinen oder Gullideckel auf die Fahrbahn, Steinewerfen von Brücken, Zerstören oder Entfernen von Verkehrsschildern, Beschädigen vom Ampelanlagen, usw.
Wenn ein Verkehrsteilnehmer sein Fahrzeug bewusst und zweckgerichtet als Waffe einsetzt, um Personen oder Gegenstände zu schädigen, in dem er z.B. eine Polizeisperre durchfährt oder bewusst in eine Menschenmenge fährt, ist der Tatbestand erfüllt. Hierbei spricht man von der sogenannten Pervertierungdes Straßenverkehrs. Dies trifft auch für Fälle des plötzlichen Abbremsens, um einen Dritten bewusst zu schädigen, zu.
Das Gesetz unterscheidet hier zwischen fahrlässigem, grob fahrlässigem und vorsätzlichem Verhalten. Hiervon abhängig können unterschiedlich hohe Strafen ausfallen.
Gefährdung des Straßenverkehrs, § 315c StGB
Diese Vorschrift kommt insbesondere in Verbindung mit der alkoholbedingten Begehungsweise erstaunlich häufig vor. § 315c StGB sanktioniert falsche Verhaltensweisen von Verkehrsteilnehmern im fließenden und ruhenden Verkehr. Durch diese falsche Verhaltensweise, müssen Menschen oder fremde Sachen einer Gefahr ausgesetzt werden.
Die Tathandlungen des Abs. 1 Nr. 2 beschreiben die sog. „7 Todsünden“: Vorfahrtmissachtung, falsches Überholen, Nichtbeachten des Fußgängerüberweges, überhöhte Geschwindigkeit an unübersichtlichen Stellen (Kreuzungen, Bahnübergängen, Straßeneinmündungen), Missachtung des Rechtshaltegebot an übersichtlichen Stellen, Wenden oder Rückwärtsfahren auf der Autobahn, Nichtkenntlichmachung, Nichtentfernung oder Nichtsicherung von liegengebliebenen Fahrzeugen.
Diese Todsünden müssen grob verkehrswidrig und rücksichtlos begangen worden sein. Die Feststellung, ob ein solches Verhalten rechtwidrig und rücksichtlos darstellt, ist oftmals schwierig einzuschätzen.
§ 315c StGB sanktioniert auch in Abs. 3 die fahrlässige Begehung von Taten.
Verbotenes Kraftfahrzeugrennen, § 315d StGB
Seit Oktober 2017 stehen auch „illegale Autorennen“gemäß § 315d StGB unter Strafe. Eine Vielzahl von Todesfällen verursacht durch unerlaubte Autorennen durch die Städte Deutschlands in Vergangenheit, war der Anlass für dieses Gesetz. Die Sanktionierung als bloße Ordnungswidrigkeit wurde nicht mehr als ausreichend gesehen. Zudem sind nun in vielen Großstädten die sogenannten „Soko Autoposer / Rennen“ auf der Jagd. Gemäß § 315d Abs. 1 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer im Straßenverkehr (Nr. 1) ein nicht erlaubtes Kraftfahrzeugrennen ausrichtet oder durchführt, (Nr. 2) als Kraftfahrzeugführer an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen teilnimmt oder (Nr. 3) sich als Kraftfahrzeugführer mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtlos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Nach dem Wortlaut dieser Norm, muss also noch nicht einmal ein Mensch oder ein Gegenstand gefährdet oder beschädigt werden. Die Vorschrift soll die Sicherheit des Straßenverkehrs und den dazugehörigen Teilnehmern gewährleisten. Die Ahndung als bloße Ordnungswidrigkeit erschien als nicht mehr ausreichend.
Für den Laien findet ein Rennen statt, wenn mindestens zwei Personen sich über einen bestimmten Streckenabschnitt duellieren. Wer das Ziel zuerst erreicht, gewinnt. Für den Gesetzgeber liegt ein Rennen vor, wenn ein Wettbewerb zur Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten mit Kraftfahrzeugen, bei denen zwischen mindestens zwei Teilnehmern ein Sieger ermittelt wird, wobei es einer vorherigen Absprache der Beteiligten nicht bedarf, vorliegt. D.h. entweder man richtet ein Rennen aus oder nimmt persönlich an diesem Teil. So fallen nicht nur organisierte Rennen unter dem Begriff, sondern auch spontane Duelle zwischen Autofahrern, die sich zufällig auf der Straße begegnen.
Straßenrennen können daher auf verschiedene Arten ausgetragen werden. Solange diese Rennen auf deutschen Straßen ohne Genehmigung stattfinden, stellen sie eine Straftat dar.
Neben dem Kraftfahrzeugrennen, steht nach Abs. 1 Nr. 3 auch das „alleinige Rasen“unter Strafe. Voraussetzung hierfür ist, dass der Täter mit nicht angepasster Geschwindigkeit, grob verkehrswidrige und rücksichtlose ein Fahrzeug führt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen.
Die Anpassung der Geschwindigkeit der Fortbewegung bezieht sich auf die konkrete Verkehrssituation (Fahrbahn, Verkehrsaufkommen, Witterung, Lichtverhältnisse), sowie auf die Leistungsfähigkeit des Fahrzeugführers. Dabei muss der Fahrer in besonders schwerer Weise gegen Verkehrsvorschriften verstoßen (grob verkehrswidrig) und sich aus eigensüchtigen Gründen über seine Pflichten gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern hinweggesetzt haben oder aus Gleichgültigkeit von vornherein Bedenken gegen sein Verhalten nicht aufkommen lassen haben (rücksichtslos).
Die Handlung muss von der Absicht getragen sein, eine „höchstmögliche Geschwindigkeit“ zu erreichen. Damit ist nicht die mit dem geführten Kfz technisch erreichbare, sondern die in der konkreten Verkehrssituation erzielbare relative Höchstgeschwindigkeit gemeint.
Insofern können Geschwindigkeitsverstöße mit weiteren Ordnungswidrigkeiten, schnell den Tatbestand des §315d Abs. 1 Nr. 3 StGB erfüllen und eine Straftat darstellen.
Wer von der Polizei erwischt und angehalten wird, verliert vor Ort noch den Führerschein (§ 69 Abs. 2 Nr. 1a StGB) und auch sein Fahrzeug als Tatmittel (§ 315f StGB). Sollte der Täter tatsächlich vor Gericht verurteilt werden, so muss er sich neben der Geld- oder Freiheitsstrafe mit einer Sperre zur Erteilung einer neuen Fahrerlaubnis einstellen (§ 69a StGB). Die Dauer der Sperre liegt zwischen sechs Monaten und fünf Jahren. Sollte gegen den Täter bereits in den letzten drei Jahren eine Sperre verhängt worden sein, so wird in diesen Fällen eine Sperre von mindestens einem Jahr verhängt. In besonders schweren Fällen, kann die Sperre auch für immer verhängt werden.
Was besonders schlimm für den Betroffenen ist, wenn das geliebte Fahrzeug einkassiert wird. Gemäß § 315f StGB können Kraftfahrzeuge, auf die sich eine Tat nach § 315d StGB bezieht, eingezogen werden. Die Aussage, das Fahrzeug gehöre einem nicht, sei geleast oder finanziert und gehöre somit der Bank oder dem Autohaus, ist für die Einziehung unbedenklich. Es kann somit auch fremdes Eigentum entzogen werden, was mittlerweile der Regelfall ist. Ziel ist hierbei die Bekämpfung der Straftaten.
Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, § 142 StGB (Fahrerflucht)
Ein kleiner Schaden beim Ein- und Ausparken, die Zeitnot und der handschriftlich hinterlegte Zettel an der Windschutzscheibe, können schnell die Unfallflucht begründen. Dies wiederum führt neben einer Strafe meist zum Führerscheinverlust, sowie Punkte in Flensburg. Oft kommt es vor, dass man erst durch die Vorladung der Polizei von einem Unfall erfährt. Diese Norm gehört zu den umstrittensten strafrechtlichen Vorschriften im StGB. Schutzzweck sind die Feststellungen zur Klärung der durch einen Unfall entstandenen zivilrechtlichen Ansprüche zu sichern. D.h. jedem Unfallbeteiligten – egal ob Verursacher oder Geschädigter – müssen die wichtigsten Daten wie z.B. Personalien des Fahrers und Halters sowie Versicherungsdaten, zugänglich gemacht werden.
Den allermeisten ist es nicht bewusst, dass die Unfallflucht eine Straftat darstellt und mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren sanktioniert wird.
Häufig kommt es vor, dass man ein parkendes und unbemanntes Fahrzeug anfährt und weit und breit kein Halter zu sehen ist. Gemäß § 142 Abs. 1 Nr. 2 StGB hat der Unfallverursacher nach den Umständen eine angemessene Zeit zu warten. Die Rechtsprechung beurteilt die Frage der jeweils angemessenen Wartezeit nicht einheitlich. Grundsätzlich gilt, je geringfügiger der Schaden und eindeutiger die Haftungsfrage, um so kürzer ist die Wartezeit. Hat man die Wartezeit entsprechend eingehalten oder sich berechtigt oder entschuldigte vom Unfallort entfernt, muss unverzüglich nachträgliche Feststellungen zu seiner Person und dem Unfallgeschehen ermöglichen z.B. bei der Polizei, andernfalls macht man sich nach § 142 Abs. 2 StGB strafbar. Ein Zettel mit den Daten am Wischer des anderen Fahrzeuges zu klemmen, reicht nicht aus!
Bei kleineren Unfällen, insbesondere bei Nacht und schlechten Witterungsverhältnissen wie Regen und Schnee, kann es vorkommen, dass man einen Zusammenstoß oder Rempler gar nicht bemerkt hat. Der Subjektive Tatbestand des § 142 StGB setzt aber Vorsatz voraus. Der Täter muss also erkannt oder wenigstens mit der Möglichkeit gerechnet haben, dass er einen Gegenstand angefahren hat. Fahrlässigkeit reicht hierfür nicht aus. Ob es für den Täter erkennbar war, kann auch anhand vieler Faktoren ausgemacht werden, wie z.B. Schadenshöhe, Wahrnehmbarkeit des Unfallgeschehens sowie Zuordnung und Kompatibilität der Schäden.
Fahren ohne Fahrerlaubnis, § 21 StVG
Wer ein Fahrzeug führt, obwohl ihm durch ein Strafgericht oder der Verwaltungsbehörde rechtskräftig die Fahrerlaubnis entzogen wurde, nach § 44 StGB oder § 25 StVG ein Fahrverbot besteht, gemäß § 111 StPO die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen wurde oder der Führerschein vorläufig Sichergestellt oder Beschlagnahmt wurde, macht sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gemäß § 21 StVG strafbar. Auch der Halter kann sich strafbar machen, wenn er Kenntnis davon hatte, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis hatte oder sich nicht zumindest hierrüber vergewissert hat. Ein besonderes Problem stellen ausländische Fahrerlaubnisse dar, nachdem im Inland zuvor eine Sperre verhängt wurde.
Neben einer Sanktionierung, wird regelmäßig die Verhängung einer isolierten Speerfrist für die Neuerteilung der Fahrerlaubnis ausgesprochen, insbesondere bei Widerholungstätern.
Entziehung der Fahrerlaubnis, Sperre und Fahrverbot
Alle Verkehrsstraftaten ziehen neben der Hauptstrafe als Nebenfolge die Entziehung der Fahrerlaubnis oder eine Sperrfrist zur Wiedererteilung der Fahrerlaubnis nach sich. Für viele stellt diese Nebenfolge das empfindlichere Übel dar, als die Hauptstrafe. Zweck dieser Maßregelung ist es, andere Verkehrsteilnehmer zu schützen.
Nach § 69 StGB wird die Fahrerlaubnis vom Gericht entzogen, wenn man wegen einer rechtswidrigen Tat im Zusammenhang mit dem Führen eines Kraftfahrzeuges verurteilt wird und dadurch zum Führen von Kraftfahrzeugen ungeeignet ist (Abs. 1). Bei den Katalogtaten in Abs. 2 (Gefährdung des Straßenverkehrs § 315c, verbotene Kraftfahrzeugrennen § 315d, Trunkenheit im Verkehr § 316, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort § 142, Vollrausch § 323a) kann regelmäßig ohne weitere Würdigung von der Ungeeignetheit ausgegangen werden.
Die Ungeeignetheit muss zum Zeitpunkt des Urteils festgestellt werden und nicht zum Tatzeitpunkt. Dies führt regelmäßig bei den Gerichten zu Problemen, da häufig zwischen Tat und Gerichtstermin u.U. mehrere Monate vergehen. Der Richter muss dann prüfen, ob der Eignungsmangel möglichweise inzwischen weggefallen ist und, ob die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis den charakterlichen Eignungsmangel mittlerweile aufgehoben hat. Dies hat auch bei den Katalogtaten zu erfolgen.
Entzieht das Gericht die Fahrerlaubnis, so bestimmt es zugleich, dass für die Dauer von 6 Monaten bis zu 5 Jahren keine neue Fahrerlaubnis erteilt werden darf, § 69a Abs. 1 StGB. Bei Wiederholungstätern erhöht sich die Mindestsperre auf 1 Jahr. Hat der Täter keine Fahrerlaubnis, wird nur die Sperre angeordnet (Abs. 1, S. 3).
Der Maßstab für die Bemessung der Sperre ist allein die voraussichtliche Dauer der Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrtzeugen. Auf die Tatschuld kommt es nicht an. Eingerechnet wird die Zeit in der die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen, sichergestellt oder beschlagnahmt war. Hierbei verkürzt sich die Mindestsperre auf 3 Monate.
In einigen Fällen kann auch lediglich eine Fahrverbot nach § 44 StGB als Nebenfolge erteilt werden.
Der beschlagnahmte Führerschein
Wer täglich berufs- oder privatbedingt auf den Straßen unterwegs ist, ist logischerweise auf seinen Führerschein angewiesen. Daher sind meistens Beschuldigte ohne Führerschein aufgeschmissen und extrem ungeduldig. Am liebsten soll der Anwalt alles unternehmen, damit zumindest der Führerschein vorläufig wieder ausgehändigt wird. Hier besteht die Möglichkeit einen Antrag auf Aufhebung der Beschlagnahme und Herausgabe des Führerscheins zu stellen.
Vorläufige Entziehung des Führerscheins, § 111a StPO
Liegen Gründe vor, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, im Urteil die Fahrerlaubnis entzogen wird, kann die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen werden. Hiergegen steht das Rechtmittel der Beschwerde (§ 304 StPO) zu. Damit soll die Entscheidung des Gerichts über die vorläufige Entziehung angefochten werden. Hier ist jedoch Vorsicht geboten. Durch die Beschwerde wird das Hauptverfahren verzögert, da eine Entscheidung über die Beschwerde Vorrang hat. Zudem kommt es häufig vor, dass der Amtsrichter die Entscheidungsgründe des Beschwerdegerichts nach einer – für den Mandanten – negativen Entscheidung gut und gerne für sein Urteil verwendet und dem Verteidiger unter die Nase reibt. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die Beschwerdegerichte nach Aktenlage entscheiden und somit ohne Hauptverhandlung und Zeugenaussagen. Vor diesem Hintergrund erscheint es fast immer sinnvoller, die Verteidigung für die Hauptverhandlung vorzubereiten, anstatt voreilig das Verfahren negativ zu beeinflussen.
MPU
Die Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) ist unter allen Führerscheinbesitzern gefürchtet, dabei geht es „lediglich“ um die Fahreignung des Antragstellers. In den allermeisten Fällen wird die MPU wegen Alkohol- oder Drogenfahrten angeordnet. Bisher drohte die MPU bei Fahrten ab 1,6 Promille und mehr, sowie ab 1,1 Promille, wenn Ausfallerscheinungen hinzukamen. Künftig droht die MPU bereits unter der 1,6 Promillegrenze, auch wenn keine Ausfallerscheinungen vorlagen, so das Bundesverwaltungsgericht in seiner Entscheidung vom März 2021.
Wer im Verkehr häufig auffällt und sein Punktekonto in Flensburg gefüllt hat, muss bei mehr als 7 Punkte oder bei besonders schwerwiegenden Verkehrsverstößen, auch sich einer MPU unterziehen.
Lassen Sie sich von mir in einem persönlichen Gespräch umfassend beraten und verteidigen.